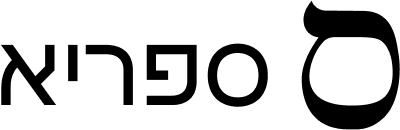Vier goldene Gestelle. Mit סניף wird ein Gegenstand bezeichnet, der einem anderen, dem Hauptgegenstand, als Nebenteil zur Stütze oder zur Ergänzung beigegeben ist, hier die Seitengestelle zum Auflegen der zwischen den Broten liegenden Röhren.
waren dort mit Seitenstangen. מפוצלין = abgezweigt, von den Gestellen zweigten sich Seitenstangen ab, welche zur Stütze für die Röhren dienten, damit diese nicht auf das Brot drückten.
an den oberen Teilen. Die Gestelle standen auf dem Fussboden zu beiden Seiten des Tisches, die Seitenstangen waren nur auf dem oberen Teile angebracht, vom Rande des Tisches nach oben.
zwei von ihnen dienten als Stützen für die eine Schicht und zwei für die andere Schicht. je zwei Gestelle standen einander gegenüber zu beiden Seiten des Tisches und stützten die auf ihren Seiten-Stangen aufliegenden quer über den Tisch gehenden Röhren.
und 28 Röhren. Nach dem Talmud (97 a) sind unter den Exod. 25, 29 genannten קשותיו die סנימין und unter מנקיותיו die Röhren zu verstehen ; sie werden מנקיות genannt, weil sie zwischen den Broten liegend dieselben rein d. h. frisch erhalten sollten, indem die Luft Zutritt hatte und dadurch die Brote nicht so schnell alt wurden. Nebenbei dienten sie auch als Stütze, dass die unten liegenden Brote nicht zu sehr von den über ihnen liegenden gedrückt wurden. Jede der beiden Schichten bestand aus 6 über einander liegenden Broten. Das unterste Brot lag direkt auf dem Tisch, zwischen diesem und dem darüber liegenden waren 3 Röhren, zwischen diesem und dem dritten Brote 3 Röhren, zwischen dem dritten und vierten 3 Röhren und zwischen dem vierten und fünften 3 Röhren, das sind zusammen 12 Röhren ; zwischen dem fünften und dem sechsten zu oberst liegenden Brote lagen nur 2 Röhren, weil das fünfte Brot nur den Druck des einen über ihm liegenden Brotes auszuhalten hatte. Im Ganzen wurden also 14 Röhren für jede der beiden Schichten, zusammen 28 Röhren gebraucht.
eine Art hohler Halbröhren. damit die Luft besser hindurchziehen konnte.
Weder das Auflegen noch das Fortnehmen. beim Wechseln der Brote.
der Röhren verdrängt den Sabbat. obwohl weder durch das Auflegen noch durch das Abnehmen ein Verbot der Tora übertreten wird, sondern nur ein rabbinisches Sabbat-Verbot (שבות), und für solche Verbote im Allgemeinen der Grundsatz gilt, dass sie im Heiligtume keine Geltung haben (אין שבות במקדש; s. Erubin X Note 60); vgl. Talmud. Sabb. 123b.
zog sie hinaus und legte sie auf die Längsseite. Mit dem Ausdruck ,auf die Längsseite des Tisches“ kann nicht gemeint sein, dass man die Röhren der Länge nach auf die Längsseite des Tisches legte, denn selbst nach der Ansicht des R. Meir war ja die ganze Tischfläche bis auf den Raum von 2 Handbreiten in der Mitte von den Broten bedeckt. Der Ausdruck kann vielmehr nur dahin verstanden werden, dass man die Röhren quer über den Tisch auf den Teil von der Länge des Tisches legte, der von den Broten nicht bedeckt war, das waren von den 12 Handbreiten, die der Tisch lang war, die 2 Handbreiten in der Mitte; auch so lässt sich diese Bestimmung der Mischna nur nach R. Meir verstehen, nicht aber nach R. Jehuda, nach dessen Ansicht die ganze Oberfläche des Tisches von den Broten bedeckt war (s. die vorige Mischna), also überhaupt kein Platz vorhanden war, wohin man die Röhren hätte legen können. Nach Tosafot meint die Mischna nicht, dass man die Röhren auf den Tisch, sondern dass man sie auf den Fussboden längs der Längsseite des Tisches legte, לארכו also = längs der Längsseite ; sie sollten in derselben Richtung liegen, in welcher, wie die Mischna gleich darauf bemerkt, die Gegenstände im Heiligtume standen, oder der Grund war, dass, wenn sie der Breite nach auf dem Fussboden gelegen hätten, die Priester leicht über sie hätten stolpern können.
des Tisches. am Sabbat legte man dann die Brote ohne die Röhren auf den Tisch und erst nach Ausgang des Sabbats wurden dann die Röhren zwischen die Brote geschoben.
standen mit ihrer Längsfläche längs der Längsseite des Hauses. das ist zwischen Ost und West, mit Ausnahme der heiligen Lade, die zwischen Nord und Süd stand ; in welcher Richtung der Leuchter stand, darüber sind die Ansichten geteilt (s. Talmud 98 b).